Ästhetik IV: Geheimsache Ghettofilm - Der entleert-gerichtete Blick hinter der Kamera
Gestern Abend wurde - um 23.30 also wie üblich unter Ausschluss der werktätigen Bevölkerung - Yael Hersonskis Geheimsache Ghettofilm gezeigt:
"Shtikat Haarchion – Geheimsache Ghettofilm" von Yael Hersonski erzählt die Geschichte eines nationalsozialistischen Propagandafilms über das Warschauer Ghetto, der 1942 begonnen, jedoch nie fertig gestellt wurde. Auf ungeklärte Weise gelangten die 62 Minuten Filmmaterial als Rohschnitt erst in ein DDR-Archiv und werden heute im Bundesfilmarchiv aufbewahrt.
Die Aufnahmen sind kurz vor der Deportation der Ghettobewohner entstanden und zeigen aufwendig inszenierte Szenen vom vermeintlichen Luxusleben der Juden im Ghetto. Diesen Szenen wurden Einstellungen gegenüber gestellt, die Hunger, Leid und Tod der deutschen Bevölkerung zeigen. Der genaue, ursprünglich geplante Verwendungszweck dieser Aufnahmen ist nicht überliefert. Jedoch ist zu vermuten, dass die Aufnahmen für einen antisemitischen Dokumentarfilm, ähnlich dem nationalsozialistischen Propaganda-Spielfilm „Der Ewige Jude“,der von einem Millionen-Publikum gesehen wurde, gemacht wurden.
Für ihren Film befragte Regisseurin Yael Hersonski Menschen, die sich an die Dreharbeiten des Propagandafilms erinnern und suchte nach Aufzeichnungen darüber in geretteten Tagebüchern von Ghetto-Bewohnern. Auch das Verhörprotokoll des damaligen Kameramanns wurde von Hersonskis für ihren Film ausgewertet. Die vom Propagandaministerium inszenierten Szenen galten lange Zeit als authentisch – sie tauchten nach dem Krieg als "Archivaufnahmen" in Dokumentationen über das Warschauer Ghetto auf – ein leider allzu typisches Beispiel für den Zynismus der NS-Propaganda und den unreflektierten Umgang damit.
Das neue an "Shtikat Haarchion“ ist, dass diese dokumentarischen Filmbilder zum ersten Mal auf ihren propagandistischen Inhalt und auf ihre Inszenierung hin überprüft worden sind. Dies übernimmt Yael Hersonski in einer Mischung aus historischer und filmanalytischer Aufarbeitung und trägt zum weiteren Verständnis der damaligen Geschehnisse bei. Die Regisseurin resümiert: "Nachdem die Welt einen Teil der Verbrechen mit eigenen Augen hatte sehen können, waren die Bilder nicht länger, was sie zuvor waren...
Shtikat Haarchion
Regie: Yael Hersonski
Produktionsland: Israel, 2009
Filmlänge: 89 min
Hebräisch, Deutsch, Polnisch, Jiddisch, Englisch Quelle: Shoa.de
... waren die Bilder nicht länger, was sie zuvor waren... : Abgesehen davon, dass man erfährt, was man ahnen konnte, dass Wag The Dog nichts Neues war: Besonders verstörend und interessant sind die Aussagen des Kameramannes, der (s. o. 1'17) sagt: "Ich wusste nie, was der Zweck der Filme war, die wir drehten" und der im folgenden auch schildert, wie unprofessionell - aus der Sicht eines Kameramannes - die Vorgaben der beteiligten Partei- und SS-Leute waren; deutlich wird aber, dass er aber offenbar genau wusste, welcher Blick der Kamera auf die Juden im Ghetto erwartet wurde. Dass sozusagen selbstverständlich der bestellte Kameramann den Blick auf die Opfer technisch realisiert, der für den Film benötigt wird, was bedeutet, dass es nich nur der entleerte Blick hinter der Kamera ist, der uns - wie in den Aufnahmen der Wehrmachtsoldaten von Hinrichtungen usw. - begegnet, sondern ein schon gerichteter Blick, der weiß - offenbar ohne dass es dem ausführenden Handwerker bewusst ist - wie er die Objekte zu sehen hat und wie er diese Sicht handwerklich optimal zu realisieren hat (vgl. im Film die Versuche unterschiedlicher Einstellungen z.B. zum Schlachter: Wie hier die Perspektive mehrfach gewechselt wird, um die Inszenierung eines Gegensatzes von reicher Jüdin und armen, hungernden Kindern möglichst sinnfällig werden zu lassen ...). Was also ist der Wahrnehmung des Kameramannes, der keine Instruktion braucht, was er zu sehen und zu filmen hat, eingeschrieben, so dass er von sich aus und ohne ein Bewusstsein davon den Pannwitz-Blick realisiert????

Die furchtbare Fortsetzung in der Gegenwart: Visiotype
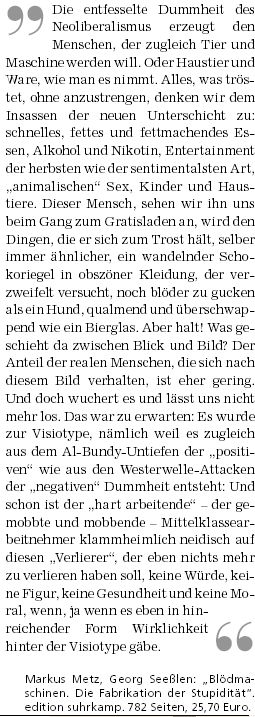
heute in meiner LieblingsHAZ zitiert ...
"Shtikat Haarchion – Geheimsache Ghettofilm" von Yael Hersonski erzählt die Geschichte eines nationalsozialistischen Propagandafilms über das Warschauer Ghetto, der 1942 begonnen, jedoch nie fertig gestellt wurde. Auf ungeklärte Weise gelangten die 62 Minuten Filmmaterial als Rohschnitt erst in ein DDR-Archiv und werden heute im Bundesfilmarchiv aufbewahrt.
Die Aufnahmen sind kurz vor der Deportation der Ghettobewohner entstanden und zeigen aufwendig inszenierte Szenen vom vermeintlichen Luxusleben der Juden im Ghetto. Diesen Szenen wurden Einstellungen gegenüber gestellt, die Hunger, Leid und Tod der deutschen Bevölkerung zeigen. Der genaue, ursprünglich geplante Verwendungszweck dieser Aufnahmen ist nicht überliefert. Jedoch ist zu vermuten, dass die Aufnahmen für einen antisemitischen Dokumentarfilm, ähnlich dem nationalsozialistischen Propaganda-Spielfilm „Der Ewige Jude“,der von einem Millionen-Publikum gesehen wurde, gemacht wurden.
Für ihren Film befragte Regisseurin Yael Hersonski Menschen, die sich an die Dreharbeiten des Propagandafilms erinnern und suchte nach Aufzeichnungen darüber in geretteten Tagebüchern von Ghetto-Bewohnern. Auch das Verhörprotokoll des damaligen Kameramanns wurde von Hersonskis für ihren Film ausgewertet. Die vom Propagandaministerium inszenierten Szenen galten lange Zeit als authentisch – sie tauchten nach dem Krieg als "Archivaufnahmen" in Dokumentationen über das Warschauer Ghetto auf – ein leider allzu typisches Beispiel für den Zynismus der NS-Propaganda und den unreflektierten Umgang damit.
Das neue an "Shtikat Haarchion“ ist, dass diese dokumentarischen Filmbilder zum ersten Mal auf ihren propagandistischen Inhalt und auf ihre Inszenierung hin überprüft worden sind. Dies übernimmt Yael Hersonski in einer Mischung aus historischer und filmanalytischer Aufarbeitung und trägt zum weiteren Verständnis der damaligen Geschehnisse bei. Die Regisseurin resümiert: "Nachdem die Welt einen Teil der Verbrechen mit eigenen Augen hatte sehen können, waren die Bilder nicht länger, was sie zuvor waren...
Shtikat Haarchion
Regie: Yael Hersonski
Produktionsland: Israel, 2009
Filmlänge: 89 min
Hebräisch, Deutsch, Polnisch, Jiddisch, Englisch Quelle: Shoa.de
... waren die Bilder nicht länger, was sie zuvor waren... : Abgesehen davon, dass man erfährt, was man ahnen konnte, dass Wag The Dog nichts Neues war: Besonders verstörend und interessant sind die Aussagen des Kameramannes, der (s. o. 1'17) sagt: "Ich wusste nie, was der Zweck der Filme war, die wir drehten" und der im folgenden auch schildert, wie unprofessionell - aus der Sicht eines Kameramannes - die Vorgaben der beteiligten Partei- und SS-Leute waren; deutlich wird aber, dass er aber offenbar genau wusste, welcher Blick der Kamera auf die Juden im Ghetto erwartet wurde. Dass sozusagen selbstverständlich der bestellte Kameramann den Blick auf die Opfer technisch realisiert, der für den Film benötigt wird, was bedeutet, dass es nich nur der entleerte Blick hinter der Kamera ist, der uns - wie in den Aufnahmen der Wehrmachtsoldaten von Hinrichtungen usw. - begegnet, sondern ein schon gerichteter Blick, der weiß - offenbar ohne dass es dem ausführenden Handwerker bewusst ist - wie er die Objekte zu sehen hat und wie er diese Sicht handwerklich optimal zu realisieren hat (vgl. im Film die Versuche unterschiedlicher Einstellungen z.B. zum Schlachter: Wie hier die Perspektive mehrfach gewechselt wird, um die Inszenierung eines Gegensatzes von reicher Jüdin und armen, hungernden Kindern möglichst sinnfällig werden zu lassen ...). Was also ist der Wahrnehmung des Kameramannes, der keine Instruktion braucht, was er zu sehen und zu filmen hat, eingeschrieben, so dass er von sich aus und ohne ein Bewusstsein davon den Pannwitz-Blick realisiert????

Die furchtbare Fortsetzung in der Gegenwart: Visiotype
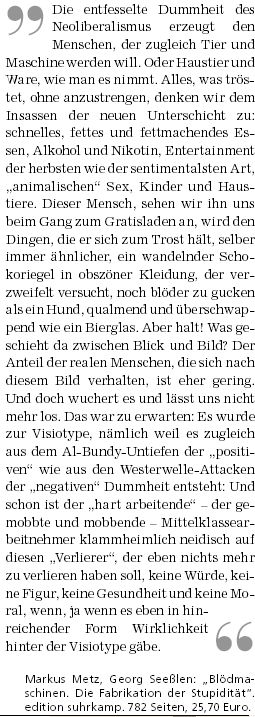
heute in meiner LieblingsHAZ zitiert ...
gebattmer - 2011/06/16 21:04

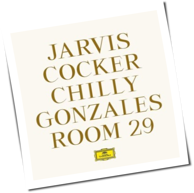


















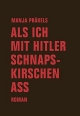



















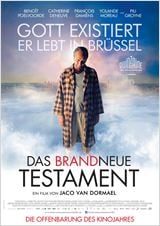


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday.net/stories/25482822/modTrackback