Archäologie (CDXVI): Geschichtsbild
Herr G. hat einen sehr schönen kleinen Film über das Geschichtsbild im Foyer der Ricarda-Huch-Schule, Hannover, veröffentlicht.
Früher wäre diese Kunstform als Kulturfilm im Kino vor dem Hauptfilm gelaufen. Das nervte zuweilen, weil man ja auf den Hauptfilm wartete; war aber vermutlich anregender für die weitere kognitive und emotionale Entwicklung des Zuschauers als die gewalttätigen Werbe- und Trailerblöcke heute.
"Schön" ist er u. a. deshalb, weil es Herrn G. vorzüglich gelingt zu vermitteln, was ein Geschichtsbild ist bzw. zu sein hat (und wie es entstehen kann bzw. sollte).
View on YouTube [via Elvira Volland]
Was ein Geschichtsbild ist, scheint zunächst unklar:
Unter einem Geschichtsbild versteht man im Allgemeinen die Summe der geschichtlichen Vorstellungen eines Menschen oder einer Gruppe. Je weniger Wissen, desto mehr Fantasie bestimmt das jeweilige Geschichtsbild. Es ist Teil des umfassenderen Weltbildes eines Menschen oder der Gruppe. Unter Geschichtsbild wird einerseits ein genereller Blickwinkel auf geschichtliches Geschehen in der Art eines Paradigmas verstanden, anderseits aber auch die (zeitbedingte und daher auch Änderungen unterliegende) Interpretation bestimmter Ereignisse und Personen, vor allem mit dem Zweck politischer Instrumentalisierung im Sinne einer Geschichtspolitik. [Wikipedia]
Aus der Perspektive einer Ästhetik des Widerstands (Peter Weiss) werden in Herrn G's Film die Schichten freigelegt, die der Archäologe dem Nicht-Archäologen zugänglich machen kann. Ohne diese Perspektive lassen sich nur affirmative Geschichtsbilder im Sinne einer bestimmten Geschichtspolitik oder Beliebigkeit erzeugen.
= Schön also und i. Ü. aufschlussreich im Hinblick auf die herrschende Geschichts-Narrativ-Sinnblase, die den Blick auf Vergangenes eher vernebelt als eröffnet:
Die Prüfung des Geltungsanspruchs von Aussagen scheint mir im Zusammenhang der konstruktivistischen Wende der Geisteswissenschaften verloren gegangen zu sein ...
Dass Herr G. mit den Schülerinnen und Schülern damals dieses Geschichtsbild realisieren konnte, ist auch einem großartigen Schulleiter zu verdanken:
Dr. Joachim Thiel, ein Humanist und Ironiker, ein Liberaler (eines Typus, den es heute nicht mehr gibt). Respekt.
Früher wäre diese Kunstform als Kulturfilm im Kino vor dem Hauptfilm gelaufen. Das nervte zuweilen, weil man ja auf den Hauptfilm wartete; war aber vermutlich anregender für die weitere kognitive und emotionale Entwicklung des Zuschauers als die gewalttätigen Werbe- und Trailerblöcke heute.
"Schön" ist er u. a. deshalb, weil es Herrn G. vorzüglich gelingt zu vermitteln, was ein Geschichtsbild ist bzw. zu sein hat (und wie es entstehen kann bzw. sollte).
View on YouTube [via Elvira Volland]
Was ein Geschichtsbild ist, scheint zunächst unklar:
Unter einem Geschichtsbild versteht man im Allgemeinen die Summe der geschichtlichen Vorstellungen eines Menschen oder einer Gruppe. Je weniger Wissen, desto mehr Fantasie bestimmt das jeweilige Geschichtsbild. Es ist Teil des umfassenderen Weltbildes eines Menschen oder der Gruppe. Unter Geschichtsbild wird einerseits ein genereller Blickwinkel auf geschichtliches Geschehen in der Art eines Paradigmas verstanden, anderseits aber auch die (zeitbedingte und daher auch Änderungen unterliegende) Interpretation bestimmter Ereignisse und Personen, vor allem mit dem Zweck politischer Instrumentalisierung im Sinne einer Geschichtspolitik. [Wikipedia]
Aus der Perspektive einer Ästhetik des Widerstands (Peter Weiss) werden in Herrn G's Film die Schichten freigelegt, die der Archäologe dem Nicht-Archäologen zugänglich machen kann. Ohne diese Perspektive lassen sich nur affirmative Geschichtsbilder im Sinne einer bestimmten Geschichtspolitik oder Beliebigkeit erzeugen.
= Schön also und i. Ü. aufschlussreich im Hinblick auf die herrschende Geschichts-Narrativ-Sinnblase, die den Blick auf Vergangenes eher vernebelt als eröffnet:
- Geschichte und Narration existieren für uns also nur vermittelt durch die Erzählung. Umgekehrt aber ist der narrative Diskurs oder die Erzählung nur das, was sie ist, sofern sie eine Geschichte enthält, da sie sonst nicht narrativ wäre [...], und insofern eben von jemandem erzählt wird, denn sonst wäre sie (wie etwa eine Sammlung archäologischer Dokumente) überhaupt kein Diskurs. Narrativ ist die Erzählung durch den Bezug auf die Geschichte, und ein Diskurs ist sie durch den Bezug auf die Narration. Die Analyse des narrativen Diskurses ist für uns also im Wesentlichen die Untersuchung der Beziehungen zwischen Erzählung und Geschichte, zwischen Erzählung und Narration sowie [...] zwischen Geschichte und Narration.
aus: Genette, Gérard (2010): Die Erzählung. 3. durchges. und korrigierte Aufl. Wilhelm Fink Verlag. Berlin. S. 13 [via Userwikis der Freien Universität Berlin > Sozial- und Kulturanthropologie]
Die Prüfung des Geltungsanspruchs von Aussagen scheint mir im Zusammenhang der konstruktivistischen Wende der Geisteswissenschaften verloren gegangen zu sein ...
Das Bild ist das, was dem Blick widersteht. Das Bild, in dem ich gefangen bin, gegen das Bild, das mich befreit.
Anmerkung:Dass Herr G. mit den Schülerinnen und Schülern damals dieses Geschichtsbild realisieren konnte, ist auch einem großartigen Schulleiter zu verdanken:
Dr. Joachim Thiel, ein Humanist und Ironiker, ein Liberaler (eines Typus, den es heute nicht mehr gibt). Respekt.
gebattmer - 2015/06/29 20:32

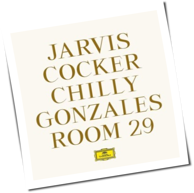


















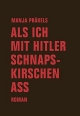



















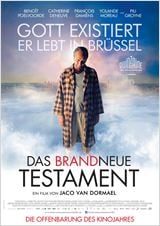


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday.net/stories/1022454475/modTrackback