Diese Nacht - Nuit de Chien
Gestern Abend (spät) zeigte 3sat als Erstausstrahlung Werner Schroeters Diese Nacht (Frankreich / Deutschland / Portugal 2008 - Originaltitel: Nuit de Chien - Regie: Werner Schroeter - Darsteller: Pascal Greggory, Bruno Todeschini, Amira Casar, Eric Caravaca, Nathalie Delon, Marc Barbé, Jean-François Stévenin - Länge: 118 min. - Start: 2.4.2009).
Ich kannte den Film nicht und fand ihn überwältigend - und bin noch nicht sicher, ob ich das gut finden soll oder eher nicht. Das Faszinierende wie das - möglicherweise - Fragwürdige dieser Überwältigungs-Ästhetik wird sehr gut herausgearbeitet in Ulrich Kriests Rezension (bei filmzentrale.com):
Hilfreich wäre es, den Film noch einmal anzusehen und zu prüfen, ob etwas von dem wahrzunehmen ist, was Rainer Werner Fassbinder in "Literatur und Leben" (1982) als Anspruch formuliert hat:
Ich kannte den Film nicht und fand ihn überwältigend - und bin noch nicht sicher, ob ich das gut finden soll oder eher nicht. Das Faszinierende wie das - möglicherweise - Fragwürdige dieser Überwältigungs-Ästhetik wird sehr gut herausgearbeitet in Ulrich Kriests Rezension (bei filmzentrale.com):
- ... Die Schrecken des 20. Jahrhunderts, eine Stadt im Belagerungszustand. Die Armee zögert den Einmarsch noch hinaus. In der Stadt marodieren die Milizen der Geheimpolizei, die Straßen liegen voller Leichen. Alte Rechnungen werden im Angesicht des angekündigten Todes beglichen, aber auch die ersten Jobs für die Zeit danach vergeben. Der Arzt und Widerstandskämpfer Ossorio Vignale durchstreift die Kaschemmen, Hotels und Folterkeller der Stadt auf der Suche nach seiner verschwundenen Geliebten Clara. Diese arbeitete als politische Journalistin, und es steht zu befürchten, dass sie ein Opfer der Geheimpolizei wurde. Hoffnungslos scheint Vignales Unterfangen, sich binnen einer Nacht Klarheit über den Frontverlauf in einer Stadt im Ausnahmezustand zu verschaffen. Alte Koalitionen sind erodiert, Freunde wurden zu Verrätern, ständig werden die Karten neu gemischt – Gerüchte machen die Runde, obschon die Infrastruktur in der Stadt weitgehend zusammengebrochen ist.
Mit seiner episodischen Erzählweise setzt Schroeter ganz auf die Situation, die Szene, nicht auf Plot, Handlung oder Spannung. Obwohl die Nacht in Terror versinkt, kann das allgemeine Durcheinander Vignale nichts anhaben, fast unverletzbar scheint er auf seiner Passage, die ihn immer wieder alte Bekannte treffen lässt. Trifft er auf Unbekannte, schützt ihn sein offenbar mythenumrankter Name. Vignale gilt vielen als Held. Warum bleibt, wie so vieles, ungeklärt. „Diese Nacht“ scheint völlig aus der Zeit gefallen...
„Diese Nacht“ ist Film, Theater, Tableaux vivants, Oper und Fado – ein Rausch der Farben und Gefühle, der so nur möglich scheint in einem Moment der Aufhebung von Geschichte. Man könnte in diesem Zusammenhang von einer dunklen Oper sprechen, wenn Schroeter radikal ästhetisierte Bilder von Folterungen und Massenerschießungen mit Musik von Mozart, Schubert, Rossini, Liszt, Beethoven oder Haydn auflädt – und dabei die Künstlichkeit der magisch ausgeleuchteten nächtlichen Dekors nochmals ins Artifizielle vorantreibt. Zugleich aber mischen sich in diesen Diskurs des Erhabenen widerstrebende Momente der Populärkultur, denn bestimmte Bilderwelten rund um die Vorstellungskomplexe Bürgerkrieg, Militärjunta, Straßensperren, Nacht der langen Messer oder auch des letzten Schiffes, das noch abfahren darf, sind hunderte Male trivialisiert und konventionalisiert worden.

- So verstörend einzigartig Schroeters multimediale Kunst heute in der Filmlandschaft auch dasteht, bestimmte historische Allianzen wie Pasolini, Visconti, Wertmüller oder vielleicht auch Fassbinder kommen schon ins Gedächtnis, insbesondere in Momenten, in denen es darum geht, dem herrschenden Terror etwas Humanes entgegen zu setzen. Das kann die Musik selbst sein, das kann auch der höchst stilisierte Moment sein, in dem der gestürzte Diktator seinen Selbstmord als überbordendes Kunstwerk inszeniert.
Kurz vor Schluss begegnen sich zwei Kinder unter der Dusche, ihr Spiel scheint erotisch und unschuldig zugleich. Übersehen sollte man dabei nicht, wie häufig von Liebe die Rede ist. Manche Figuren geben sich in dieser Nacht der Freude des Moments hin, andere verzehren sich voller Sehnsucht, immer darauf hoffend, den schmerzlich vermissten Geliebten noch einmal zu sehen. So düster und apokalyptisch Schroeters Film zu sein scheint, letztlich singt er ein Hohelied der Liebe und der Sehnsucht, auch oder gerade in Zeiten, in denen in jeder Hinsicht Ausnahmezustand herrscht. Inwieweit dieses Moment nun wieder (politisch) naiv oder geradezu obszön ist, inwieweit hier der Schrecken zur Feier der Schönheit missbraucht wird, das hängt davon ab, wie weit man gewillt ist, Schroeters radikaler Kunst-Ideologie der Schau- und Hör-Lust zu folgen.
Hilfreich wäre es, den Film noch einmal anzusehen und zu prüfen, ob etwas von dem wahrzunehmen ist, was Rainer Werner Fassbinder in "Literatur und Leben" (1982) als Anspruch formuliert hat:
- Die Verfilmung von Literatur legitimiert sich, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, keinesfalls durch eine möglichst kongeniale Übersetzung eines Mediums (Literatur) in ein anderes (Film). Die filmische Beschäftigung mit einem literarischen Werk darf also nicht ihren Sinn darin sehen, etwa die Bilder, die Literatur beim Leser entstehen läßt, maximal zu erfüllen. Dieser Anspruch wäre ohnehin in sich absurd, da jeder Leser jedes Buch mit seiner eigenen Wirklichkeit liest und somit jedes Buch so viele verschiedene Phantasien und Bilder provoziert, wie er Leser hat. Es gibt also keine endgültige objektive Realität eines literarischen Werkes, darum darf auch die Absicht eines Films, der sich mit Literatur auseinandersetzt, nicht darin liegen, die Bilderweit eines Dichters als endgültig erfüllte Übereinstimmung verschiedener Phantasien zu sein. Der Versuch, Film als Ersatz eines Stückes Literatur zu machen, ergäbe den kleinsten gemeinsamen Nenner von Phantasie, wäre also zwangsläufig im Ergebnis medioker und stumpf. Ein Film, der sich mit Literatur und mit Sprache auseinandersetzt, muß diese Auseinandersetzung ganz deutlich, klar und transparent machen, darf in keinem Moment seine Phantasie zur allgemeinen werden lassen, muß sich immer in jeder Phase als eine Möglichkeit der Beschäftigung mit bereits formulierter Kunst zu erkennen geben. Nur so, mit der eindeutigen Haltung des Fragens an Literatur und Sprache, des Überprüfens von Inhalten und Haltungen eines Dichters, mit seiner als persönlich erkennbaren Phantasie zu einem literarischen Werk legitimiert sich deren Verfilmung.
gebattmer - 2012/09/07 16:25

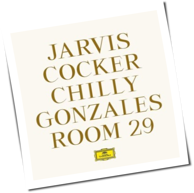


















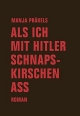



















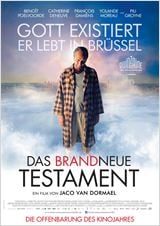


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday.net/stories/142781275/modTrackback