Deutsche Feuilletonisten
...
SPIEGEL:
Wann war endlich Schluss mit dem Blutvergießen?
Ottomeyer:
Das Barock stand im Zeichen des Neuaufbaus. Man versuchte über den Export von Luxuswaren die Wirtschaft wieder anzuwerfen. Einen echten Neuanfang schaffte aber erst Napoleon.
SPIEGEL:
Weil er das Heilige Römische Reich wegfegte?
Ottomeyer:
Richtig. Das Land war bis dahin mit Verordnungen überkrustet. Nichts ging mehr. Da lag das Wasserrecht bei diesem Kloster, man brauchte diese Genehmigung der Stadt, jene Erlaubnis des Grafen.
SPIEGEL:
Klingt überraschend aktuell.
Ottomeyer:
Ja, eine Situation wie heute. Es brauchte die Auflösung des Reichsverbandes mit
seinem 1000-jährigen Gesetzeswerk. Zwar war Deutschland bis 1815 noch zu stark geschwächt, aber dann kam es gewaltig. Die Zünfte waren aufgehoben, es gab eine neue Gewerbeverfassung, das Kreditwesen blühte auf.
SPIEGEL:
Kann man sagen – Stichwort Powerhouse –, das 19. war das deutsche Jahrhundert?
Ottomeyer:
Durchaus. „Made in Germany“ ist von den Briten als Schimpfwort eingeführt worden, um die angeblich minderwertigen Erzeugnisse der Konkurrenten zu kennzeichnen. Ende des 19. Jahrhunderts war Deutschland das erste Mal Exportwelt-
meister.
SPIEGEL:
Es folgten militärische Siege gegen Dänemark 1864, Österreich 1866, dann 1871 gegen Frankreich. Woher diese entfesselte Kraft?
Ottomeyer:
Für mich ist es ein Rätsel, was zwischen 1855 und 1871 passierte. Eben
noch, nach der gescheiterten Revolution 1848/49 ausgehungert, noch im Armenkleid des Biedermeiers, stieg das Land jäh zur wirtschaftlichen Weltmacht empor.
SPIEGEL:
Versuchen Sie eine Erklärung.
Ottomeyer:
Seit 1520 gab es ständig diese Wellen: Das Volk schafft rasend schnell Wohlstand, dann wird alles wieder eingerissen. Weite Teile Kassels oder Münchens zum Beispiel sind in einem einzigen Jahr – 1913 – gebaut worden: Brücken, Opern, Häuserviertel. Und das nur, um wenige Jahre später nach dem verlorenen Krieg wieder mit leeren Händen dazustehen.
SPIEGEL:
Was lernen wir daraus?
Ottomeyer:
Wir leben auf den Trümmern der Vergangenheit. Sie umgeben und umzüngeln uns. Alles erzählt etwas, ist Zeugnis für die zerstörerischen Kräfte des Menschen. Aber immer wieder gibt es auch dieses Ringen um Auswege, um Ausgleich und die Sehnsucht nach Frieden...
Das Gespräch mit dem Generaldirektor des Kohl-Museums in Berlin führten die Redakteure Matthias Matussek und Matthias Schulz. (Spiegel vom 22.05.06). Vergangene Woche nun war Matussek-Woche. Am Montag saß er mit einem Haufen anderer Dummschwätzer beim Versicherungsvertreter (Beckmann) und promotete sein Deutchland-Buch, am Dienstag bachte ihn meine LieblingsHAZ auf einer „Kultur“ genannten Seite wegen des selben Machwerks groß raus:
Matussek wäre nicht der grandiose Polemiker, forderte er nicht alle diejenigen, die die mehr als tausendjährige deutsche Geschichte, einschließlich der großen Kulturgeschichte, auf die zwölf Nazi-Schandjahre reduzieren, dazu auf, der deutschen Historie gerecht zu werden. Aber auch diese Deutschen seien dabei, sich aufs Vaterland zu besinnen: „All die Pappnasen, die noch vor fünf Jahren nach einer Lichterkette gerufen hätten, wenn das Wort Deutschland ohne erläuternde Verweise auf die Große Schuld gefallen wäre …, machen mit, weil sie kapiert haben, dass ihnen das Land früher oder später um die Ohren fliegt, wenn sie es nicht mit Zuspruch versehen.“
Für den HAZ-Michels ist grandioser Polemiker, wer Antifaschisten in einem verschwurbelten Satz sich Pappnasen zu nennen traut. Es ist schon faszinierend, wie offen sie daherreden. Man täusche sich nicht; - was so vordergründig flapsig-blöde daherkommt (Powerhouse: das 19. als das deutsche Jahrhundert ????) und mit den Fragen und dummen Bemerkungen die schlichten Vorlagen für die InitiativeNeueSozialeMarktwirtschaft –mäßigen Antworten liefert, lässt doch ein recht robustes Geschichts- (und Gegenwarts)verständnis erkennen:
Land mit Verordnungen überkrustet (eine Situation wie heute, brauchte:) -> Aufhebung des Reichsverbandes -> Land kommt gewaltig -> Exportweltmeister (Luxuswaren!) -> Volk schafft Wohlstand und reißt wieder ein = Krieg = neue Brücken, Opern, Häuserviertel (warum nicht ganze?) = neuer Aufschwung = Trümmer der Vergangenheit umzüngeln uns (auch ein schönes Bild).
Got it?
Matusseks Buch heißt übrigens Wir Deutschen. Warum uns die andern gern haben können.
Hier noch ein Ausschnitt aus einem schönen Text von Gerhard Henschel, der entstand, als Herr Matuessk sich im Spiegel schon einmal an Heine verging:
"Wir aber nicken ihm anerkennend zu." Wir, das sind in diesem Falle Matthias und Matussek, die sich Heinrich Heine nach dem anerkennenden Zunicken an die Fersen heften und von Traumgesichten berichten: "Wir sehen, wie er das Feuilleton der ›Zeit‹ ungelesen zur Seite legt, wie er zahlt und sich auf den Weg macht, durch die blaue Stunde des deutschen Wintermärchens, und wie er, eine Weile später, die Kastanienallee am Prenzlauer Berg hinabschlendert." Ach? "Er kommt an einer Boutique vorbei, die einen Durchreiche-Verkauf auf die Straße hat, so wie Tankstellen um Mitternacht oder Apotheken-Notdienste." Eine Boutique, "die einen Durchreiche-Verkauf auf die Straße hat" - eleganter hätte auch der Champ die deutsche Alltagssprache nicht benutzen und zum Singen bringen können. Aber nun ist schon alles egal, das Mühlrad stäubt Diamanten, die Meerfrau steigt aus den Wellen, und Heinrich Heine-Matussek verweilt ein wenig vor jener Boutique, die einen Durchreiche-Verkauf auf die Straße hat: "Ein wunderschönes rothaariges Mädchen steht in diesem Laden, der hell erleuchtet ist wie eine Installation von Joseph Beuys." Was hat Beuys in einem Feuilleton über Heine verloren? Alles und nichts. Jetzt ist kein Halten mehr, denn in dem Laden steht nicht nur ein wunderschönes Mädchen: "Da sind Metallregale, auf denen Pakete stehen, die wie DDR-Mehl aussehen, und Drahtbügel und besonders schöne Leitz-Ordner und Nickis aus Frottee." Pakete, die wie Mehl aussehen? Ob Matussek betrunken war? "Das Mädchen beteuert, daß man all die Dinge tatsächlich kaufen könne. Leider laufe der Laden sehr schlecht. Sie habe ja auch nicht Bewirtschaftung studiert, sondern Kunst."
Dem jungen Heine träumte, wie man weiß, von hübschen Locken, Myrten und Resede, von süßen Lippen und von bittrer Rede über den Fehler, nie das Studienfach "Bewirtschaftung" gewählt zu haben.
"Natürlich erkennt Heine sofort, daß das blasse Mädchen eine Prinzessin aus alten Zeiten ist, das in diesem Rätselgarten sitzt" - sitzt? Eben hat es noch gestanden und nicht gesessen, das Prinzessin, was natürlich daran liegen könnte, daß der Autor gleichzeitig einen sitzen und einen stehen gehabt hat, aber das spielt nun auch keine Rolle mehr. Zurück zur Prinzessin - "das in diesem Rätselgarten sitzt und wartet, daß es erlöst wird". Aus dem schlecht laufenden Rätselgarten mit dem Durchreiche-Verkauf auf die Straße. Und was tut Heine? "Er kauft einen Leitz-Ordner mit einem roten Plastikring im Rücken." Aha. Und erkennt er noch mehr? "Und er erkennt, daß er nicht nur verstanden wird, sondern, viel wichtiger, geträumt."
Von Matthias Matussek. Wenn heute einer Deutschland ist, dann der.
SPIEGEL:
Wann war endlich Schluss mit dem Blutvergießen?
Ottomeyer:
Das Barock stand im Zeichen des Neuaufbaus. Man versuchte über den Export von Luxuswaren die Wirtschaft wieder anzuwerfen. Einen echten Neuanfang schaffte aber erst Napoleon.
SPIEGEL:
Weil er das Heilige Römische Reich wegfegte?
Ottomeyer:
Richtig. Das Land war bis dahin mit Verordnungen überkrustet. Nichts ging mehr. Da lag das Wasserrecht bei diesem Kloster, man brauchte diese Genehmigung der Stadt, jene Erlaubnis des Grafen.
SPIEGEL:
Klingt überraschend aktuell.
Ottomeyer:
Ja, eine Situation wie heute. Es brauchte die Auflösung des Reichsverbandes mit
seinem 1000-jährigen Gesetzeswerk. Zwar war Deutschland bis 1815 noch zu stark geschwächt, aber dann kam es gewaltig. Die Zünfte waren aufgehoben, es gab eine neue Gewerbeverfassung, das Kreditwesen blühte auf.
SPIEGEL:
Kann man sagen – Stichwort Powerhouse –, das 19. war das deutsche Jahrhundert?
Ottomeyer:
Durchaus. „Made in Germany“ ist von den Briten als Schimpfwort eingeführt worden, um die angeblich minderwertigen Erzeugnisse der Konkurrenten zu kennzeichnen. Ende des 19. Jahrhunderts war Deutschland das erste Mal Exportwelt-
meister.
SPIEGEL:
Es folgten militärische Siege gegen Dänemark 1864, Österreich 1866, dann 1871 gegen Frankreich. Woher diese entfesselte Kraft?
Ottomeyer:
Für mich ist es ein Rätsel, was zwischen 1855 und 1871 passierte. Eben
noch, nach der gescheiterten Revolution 1848/49 ausgehungert, noch im Armenkleid des Biedermeiers, stieg das Land jäh zur wirtschaftlichen Weltmacht empor.
SPIEGEL:
Versuchen Sie eine Erklärung.
Ottomeyer:
Seit 1520 gab es ständig diese Wellen: Das Volk schafft rasend schnell Wohlstand, dann wird alles wieder eingerissen. Weite Teile Kassels oder Münchens zum Beispiel sind in einem einzigen Jahr – 1913 – gebaut worden: Brücken, Opern, Häuserviertel. Und das nur, um wenige Jahre später nach dem verlorenen Krieg wieder mit leeren Händen dazustehen.
SPIEGEL:
Was lernen wir daraus?
Ottomeyer:
Wir leben auf den Trümmern der Vergangenheit. Sie umgeben und umzüngeln uns. Alles erzählt etwas, ist Zeugnis für die zerstörerischen Kräfte des Menschen. Aber immer wieder gibt es auch dieses Ringen um Auswege, um Ausgleich und die Sehnsucht nach Frieden...
Das Gespräch mit dem Generaldirektor des Kohl-Museums in Berlin führten die Redakteure Matthias Matussek und Matthias Schulz. (Spiegel vom 22.05.06). Vergangene Woche nun war Matussek-Woche. Am Montag saß er mit einem Haufen anderer Dummschwätzer beim Versicherungsvertreter (Beckmann) und promotete sein Deutchland-Buch, am Dienstag bachte ihn meine LieblingsHAZ auf einer „Kultur“ genannten Seite wegen des selben Machwerks groß raus:
Matussek wäre nicht der grandiose Polemiker, forderte er nicht alle diejenigen, die die mehr als tausendjährige deutsche Geschichte, einschließlich der großen Kulturgeschichte, auf die zwölf Nazi-Schandjahre reduzieren, dazu auf, der deutschen Historie gerecht zu werden. Aber auch diese Deutschen seien dabei, sich aufs Vaterland zu besinnen: „All die Pappnasen, die noch vor fünf Jahren nach einer Lichterkette gerufen hätten, wenn das Wort Deutschland ohne erläuternde Verweise auf die Große Schuld gefallen wäre …, machen mit, weil sie kapiert haben, dass ihnen das Land früher oder später um die Ohren fliegt, wenn sie es nicht mit Zuspruch versehen.“
Für den HAZ-Michels ist grandioser Polemiker, wer Antifaschisten in einem verschwurbelten Satz sich Pappnasen zu nennen traut. Es ist schon faszinierend, wie offen sie daherreden. Man täusche sich nicht; - was so vordergründig flapsig-blöde daherkommt (Powerhouse: das 19. als das deutsche Jahrhundert ????) und mit den Fragen und dummen Bemerkungen die schlichten Vorlagen für die InitiativeNeueSozialeMarktwirtschaft –mäßigen Antworten liefert, lässt doch ein recht robustes Geschichts- (und Gegenwarts)verständnis erkennen:
Land mit Verordnungen überkrustet (eine Situation wie heute, brauchte:) -> Aufhebung des Reichsverbandes -> Land kommt gewaltig -> Exportweltmeister (Luxuswaren!) -> Volk schafft Wohlstand und reißt wieder ein = Krieg = neue Brücken, Opern, Häuserviertel (warum nicht ganze?) = neuer Aufschwung = Trümmer der Vergangenheit umzüngeln uns (auch ein schönes Bild).
Got it?
Matusseks Buch heißt übrigens Wir Deutschen. Warum uns die andern gern haben können.
Hier noch ein Ausschnitt aus einem schönen Text von Gerhard Henschel, der entstand, als Herr Matuessk sich im Spiegel schon einmal an Heine verging:
"Wir aber nicken ihm anerkennend zu." Wir, das sind in diesem Falle Matthias und Matussek, die sich Heinrich Heine nach dem anerkennenden Zunicken an die Fersen heften und von Traumgesichten berichten: "Wir sehen, wie er das Feuilleton der ›Zeit‹ ungelesen zur Seite legt, wie er zahlt und sich auf den Weg macht, durch die blaue Stunde des deutschen Wintermärchens, und wie er, eine Weile später, die Kastanienallee am Prenzlauer Berg hinabschlendert." Ach? "Er kommt an einer Boutique vorbei, die einen Durchreiche-Verkauf auf die Straße hat, so wie Tankstellen um Mitternacht oder Apotheken-Notdienste." Eine Boutique, "die einen Durchreiche-Verkauf auf die Straße hat" - eleganter hätte auch der Champ die deutsche Alltagssprache nicht benutzen und zum Singen bringen können. Aber nun ist schon alles egal, das Mühlrad stäubt Diamanten, die Meerfrau steigt aus den Wellen, und Heinrich Heine-Matussek verweilt ein wenig vor jener Boutique, die einen Durchreiche-Verkauf auf die Straße hat: "Ein wunderschönes rothaariges Mädchen steht in diesem Laden, der hell erleuchtet ist wie eine Installation von Joseph Beuys." Was hat Beuys in einem Feuilleton über Heine verloren? Alles und nichts. Jetzt ist kein Halten mehr, denn in dem Laden steht nicht nur ein wunderschönes Mädchen: "Da sind Metallregale, auf denen Pakete stehen, die wie DDR-Mehl aussehen, und Drahtbügel und besonders schöne Leitz-Ordner und Nickis aus Frottee." Pakete, die wie Mehl aussehen? Ob Matussek betrunken war? "Das Mädchen beteuert, daß man all die Dinge tatsächlich kaufen könne. Leider laufe der Laden sehr schlecht. Sie habe ja auch nicht Bewirtschaftung studiert, sondern Kunst."
Dem jungen Heine träumte, wie man weiß, von hübschen Locken, Myrten und Resede, von süßen Lippen und von bittrer Rede über den Fehler, nie das Studienfach "Bewirtschaftung" gewählt zu haben.
"Natürlich erkennt Heine sofort, daß das blasse Mädchen eine Prinzessin aus alten Zeiten ist, das in diesem Rätselgarten sitzt" - sitzt? Eben hat es noch gestanden und nicht gesessen, das Prinzessin, was natürlich daran liegen könnte, daß der Autor gleichzeitig einen sitzen und einen stehen gehabt hat, aber das spielt nun auch keine Rolle mehr. Zurück zur Prinzessin - "das in diesem Rätselgarten sitzt und wartet, daß es erlöst wird". Aus dem schlecht laufenden Rätselgarten mit dem Durchreiche-Verkauf auf die Straße. Und was tut Heine? "Er kauft einen Leitz-Ordner mit einem roten Plastikring im Rücken." Aha. Und erkennt er noch mehr? "Und er erkennt, daß er nicht nur verstanden wird, sondern, viel wichtiger, geträumt."
Von Matthias Matussek. Wenn heute einer Deutschland ist, dann der.
gebattmer - 2006/06/03 22:40

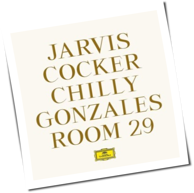


















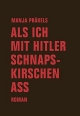



















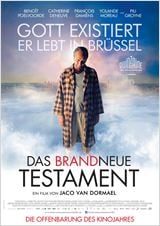


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday.net/stories/2115408/modTrackback