Eine gnaue Betrachtung der äußeren Dinge: Heinrich Kley (1863-1945) Ein Meister der Zeichenfeder

Was sind das für Zeiten, in denen der Besuch einer Kunstausstellung ein Verbrechen geheißen werden müsste, weil er das Absehen von so vielen Dingen beinhaltet? Aber so, wie jedes Gespräch über Bäume nun immer auch ein politisches Gespräch ist, so ist auch der Besuch einer Kunstausstellung sehr häufig ein Versuch, die Augen anders als von der Medienherrschaft erhofft, zu öffnen. Und wenn man die Bilder von Heinrich Kley, ausgestellt im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover (vom 22. Mai bis 21. August 2011) betrachtet, die in den ersten beiden Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden, kann man sich des Eindrucks eines Déja Vu nicht erwehren: Krisen, Katastrophen und Korruptionen des Jahres 1911 ähneln wahrhaft verteufelt den Krisen, Katastrophen und Korruptionen des Jahres 2011. Und wir könnten ebenso verteufelt gut den einen oder anderen Heinrich Kley unter unseren Bilderproduzenten brauchen. (Teufel sind, nebenbei gesagt, etwas, das Heinrich Kley einfach gern gemalt und gezeichnet hat.)
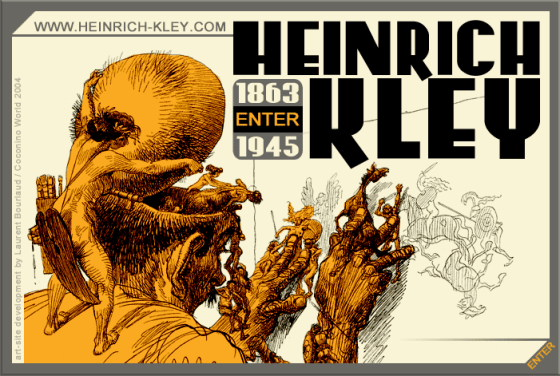
Es ist die Zeit, in der der Bilderhunger der Menschen noch nicht vollständig von der Fotografie befriedigt werden kann, das Kino noch nach Formen und Orten sucht, das Kunstwerk seinen Schritt ins Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit selber noch nicht verarbeitet hat, das Sichtbare aber sich rasant ändert durch den neuen Schub der Industrialisierung, durch ökonomische und kulturelle Brüche, und wo man nach Bildern der Unruhe verlangt, oder nach „gefährlichen Grotesken“, wie das bei Heinrich Kley heißt. Bürgerliche Kunst, sagt

man, verschloss die Augen vor dieser Welt der Maschinen, der Förderbänder, der Hochöfen und der Eisenbahnen, der politischen Ranküne und der alltäglichen Katastrophen durch die Tücken der neuen Objekte und noch mehr die Tücke der neuen Subjekte, träumte sich in Natur und Antike, in Mythos und Innenraum, modernisierte lieber den Blick als ihn auf das Modernisierte zu richten. So einfach ist es natürlich wieder einmal nicht; dennoch ist unübersehbar ein Bruch zwischen der „großen Kunst“ zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts und der Gebrauchsbilderproduktion, der Illustration, der Karikatur, dem phantastischen Zeit-Bild. Es ist, als würde man in verschiedene Richtungen blicken und hätte nur einen gemeinsamen Bezugspunkt: die innere wie äußere Zensur...
Georg Seeßlen, HEINRICH KLEY: EIN BILDPRODUZENT DES BEGINNENDEN 20. JAHRHUNDERTS IST ZU ENTDECKEN
Seeßlen lesen, Austellung besuchen!
gebattmer - 2011/06/14 23:03

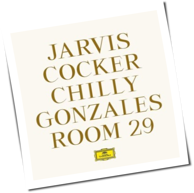


















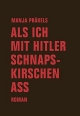



















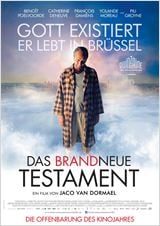


















Trackback URL:
https://gebattmer.twoday.net/stories/25480259/modTrackback