Sie sagen: "Nichts" (II)
... brauchen dafür aber eine Juniorprofessur für Reformkommunikation.
Wer genauer wissen will, was es mit diesem Begriff auf sich hat, der kann sich zum Beispiel in einem "Diskussionspapier" der als äußerst reformfreudig bekannten Bertelsmannstiftung mit dem Titel:
Politische Reformkommunikation. Veränderungsprozesse überzeugend vermitteln, informieren:
... Gerade bei Reformen, die zunächst schmerzliche Eingriffe in Besitzstände
relevanter Wählergruppen bringen, müssen Reformbedarf, Reformprozess
und Reformergebnis in der richtigen Weise und in der richtigen Gewichtung
vermittelt werden. Gefordert ist die Orientierungsleistung der Politik, Ziele und
Methoden des eingeschlagenen Reformkurses nicht nur technokratisch
(Alternativlosigkeit), sondern auch normativ (beste gangbare Alternative) zu
begründen. Besonders berücksichtigt werden müssen dabei vorhandene
gesellschaftliche Werte- und Einstellungsmuster – auch um sie gegebenenfalls
durch gezielte Kommunikationsstrategien zu verändern.
Daher sollte der Reformprozess mit der Schaffung von Problembewusstsein
für die Reformnotwendigkeit eingeleitet werden: Problem und Problemhintergrund
gilt es darzustellen, bisher nicht gesehene Zusammenhänge zu
erklären und die daraus resultierenden Fragen mit den Adressaten zu erörtern.
Positive Rhetorik hebt die attraktiven Seiten des künftigen Reformergebnisses
hervor und stärkt die Zuversicht, den Reformprozess meistern zu können.
Dabei muss das Gesagte verständlich sein und zur Wirklichkeit passen: Die
Bezeichnungen für die unter Rot-Grün eingeführten Arbeitsmarktinstrumente
dagegen standen in ihrer werbe- bzw. managementsprachlichen Konnotation
entweder nicht in Einklang mit den realen Inhalten der zu vermittelnden
Maßnamen oder wurden als inhuman und technokratisch empfunden
(„Arbeitslosengeld II“, „Ein-Euro-Job“).
Als gelungenes Gegenbeispiel lässt sich der Ansatz der britischen Labour
Regierung oder der US-amerikanischen Clinton-Administration anführen,
Reformmaßnahmen immer als „Modernisierung“ zu kommunizieren und mit
positiven Zielvisionen zu verknüpfen („Welfare to work“, Klassifizierung von
Regierungsausgaben als „Investments“)...
Stumberger bei tp: So wird der Begriff der Reform selbst quasi als Entität gebraucht, als ob es nicht höchst unterschiedliche "Reformen" gäbe. Rein vom Begriff her gesehen erscheint in der "Reformkommunikation" die Reform aber als politisches Neutrum, dem es – ganz technokratisch wertfrei – zur Durchsetzung zu verhelfen sei. Wohin eine Reform zielt, ist dabei völlig egal, in diesem Sinne waren auch die nationalsozialistischen Rassengesetze eine "Reform". ...
Vgl auch Nichts
Wer genauer wissen will, was es mit diesem Begriff auf sich hat, der kann sich zum Beispiel in einem "Diskussionspapier" der als äußerst reformfreudig bekannten Bertelsmannstiftung mit dem Titel:
Politische Reformkommunikation. Veränderungsprozesse überzeugend vermitteln, informieren:
... Gerade bei Reformen, die zunächst schmerzliche Eingriffe in Besitzstände
relevanter Wählergruppen bringen, müssen Reformbedarf, Reformprozess
und Reformergebnis in der richtigen Weise und in der richtigen Gewichtung
vermittelt werden. Gefordert ist die Orientierungsleistung der Politik, Ziele und
Methoden des eingeschlagenen Reformkurses nicht nur technokratisch
(Alternativlosigkeit), sondern auch normativ (beste gangbare Alternative) zu
begründen. Besonders berücksichtigt werden müssen dabei vorhandene
gesellschaftliche Werte- und Einstellungsmuster – auch um sie gegebenenfalls
durch gezielte Kommunikationsstrategien zu verändern.
Daher sollte der Reformprozess mit der Schaffung von Problembewusstsein
für die Reformnotwendigkeit eingeleitet werden: Problem und Problemhintergrund
gilt es darzustellen, bisher nicht gesehene Zusammenhänge zu
erklären und die daraus resultierenden Fragen mit den Adressaten zu erörtern.
Positive Rhetorik hebt die attraktiven Seiten des künftigen Reformergebnisses
hervor und stärkt die Zuversicht, den Reformprozess meistern zu können.
Dabei muss das Gesagte verständlich sein und zur Wirklichkeit passen: Die
Bezeichnungen für die unter Rot-Grün eingeführten Arbeitsmarktinstrumente
dagegen standen in ihrer werbe- bzw. managementsprachlichen Konnotation
entweder nicht in Einklang mit den realen Inhalten der zu vermittelnden
Maßnamen oder wurden als inhuman und technokratisch empfunden
(„Arbeitslosengeld II“, „Ein-Euro-Job“).
Als gelungenes Gegenbeispiel lässt sich der Ansatz der britischen Labour
Regierung oder der US-amerikanischen Clinton-Administration anführen,
Reformmaßnahmen immer als „Modernisierung“ zu kommunizieren und mit
positiven Zielvisionen zu verknüpfen („Welfare to work“, Klassifizierung von
Regierungsausgaben als „Investments“)...
Stumberger bei tp: So wird der Begriff der Reform selbst quasi als Entität gebraucht, als ob es nicht höchst unterschiedliche "Reformen" gäbe. Rein vom Begriff her gesehen erscheint in der "Reformkommunikation" die Reform aber als politisches Neutrum, dem es – ganz technokratisch wertfrei – zur Durchsetzung zu verhelfen sei. Wohin eine Reform zielt, ist dabei völlig egal, in diesem Sinne waren auch die nationalsozialistischen Rassengesetze eine "Reform". ...
Vgl auch Nichts
gebattmer - 2010/02/18 15:56

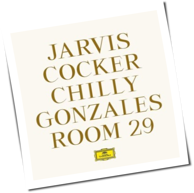


















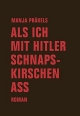



















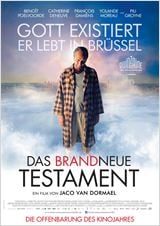


















auch hier noch als passende ergänzung:
gruß
mo